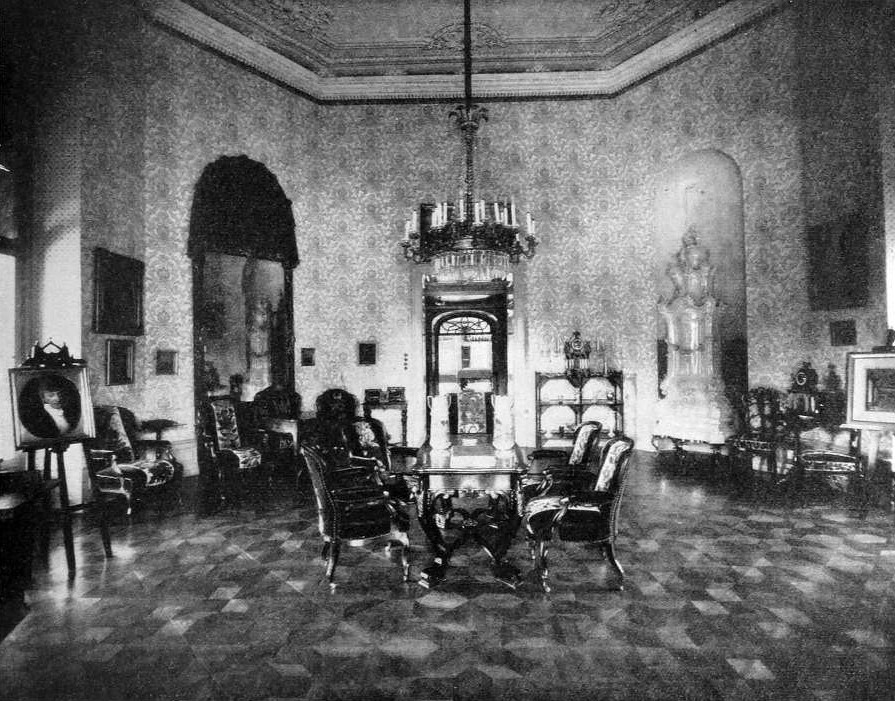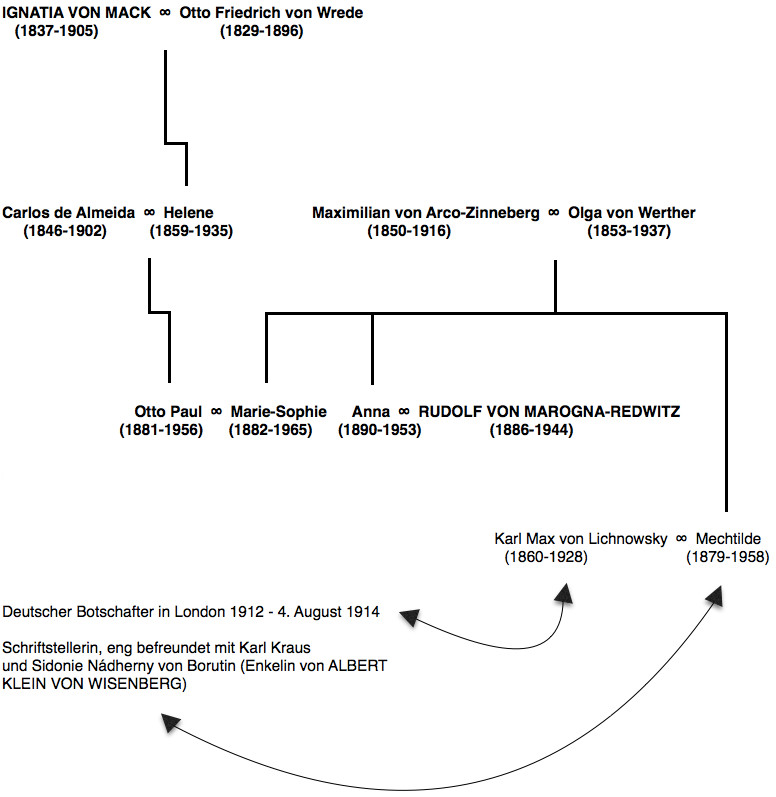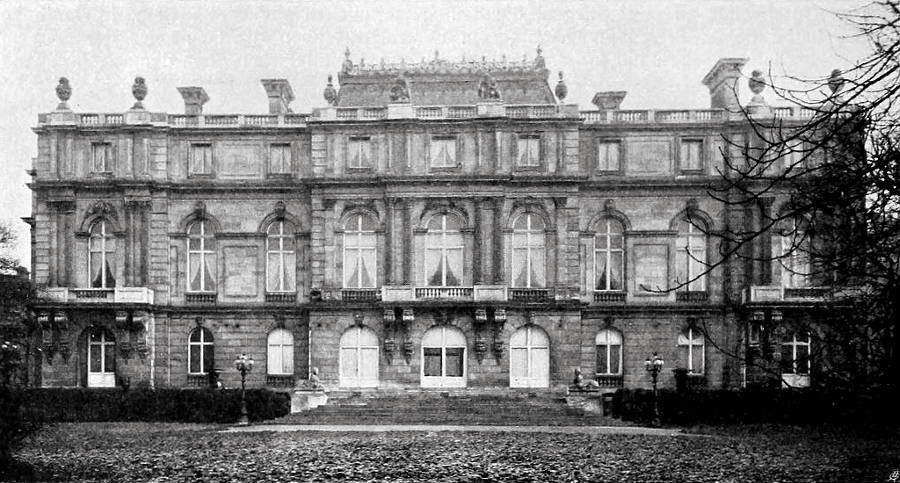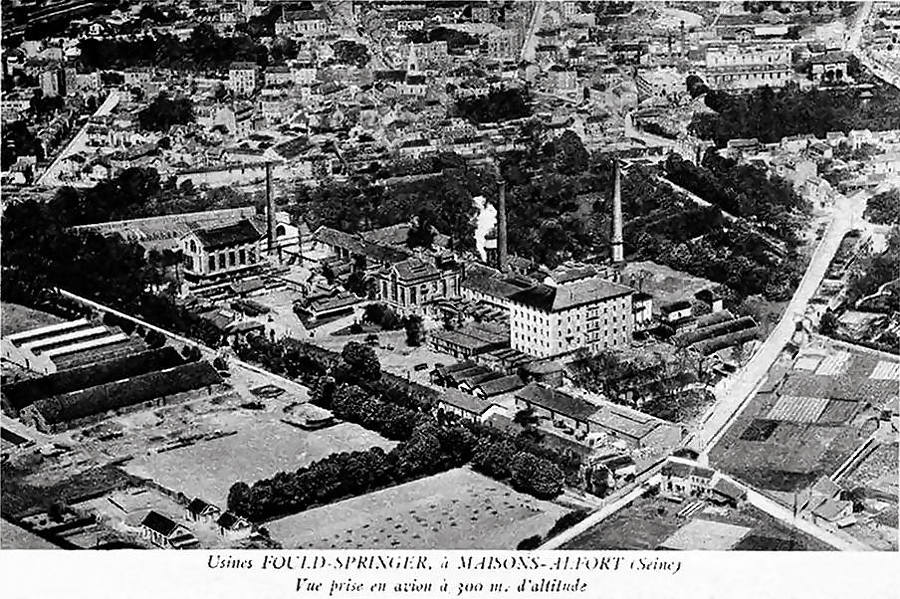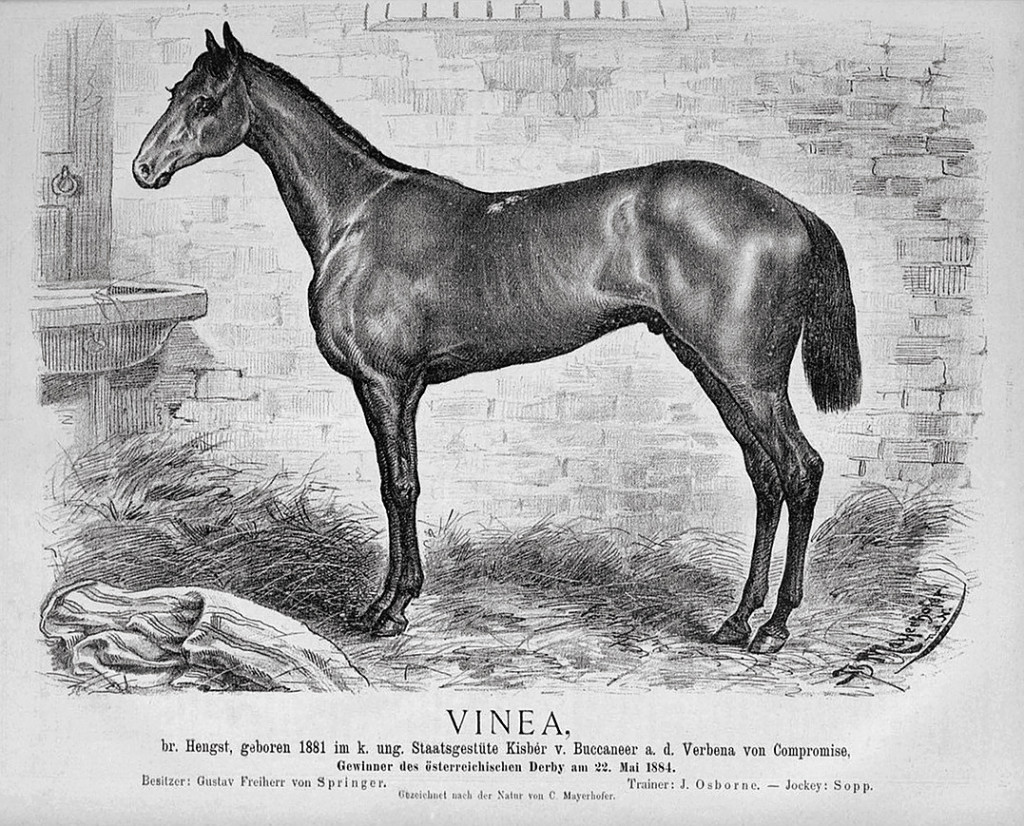Der legendäre Freimaurer: Eugen Lennhoff, Böcklinstraße 53 (1921–1934)
1968 veröffentlicht der US-amerikanische Schriftsteller John Irving den Roman Setting Free the Bears. Die deutschsprachige Übersetzung erfolgt 1985 unter dem Titel Laßt die Bären los!. Wir lesen:
»Lennhoff«, sagt der Chauffeur. »Und er hatte es eilig.«
»Inzwischen hätten Sie einen Cognac trinken können«, sagt der Ober.
»Chefredakteur Lennhoff?« sagt Zahn.
»Vom Telegraph«, sagt der Chauffeur und wischt seinen eigenen Atem von der Scheibe – schielt Hilkes Ausschnitt hinunter.
»Lennhoff ist der beste«, sagt Zahn.
»Er schreibt klipp und klar«, sagt der Chauffeur.
»Er riskiert auch was«, sagt der Ober.1
Folgende These: John Irving hat (auf wessen Empfehlung?) The Last Five Hours of Austria intensiv studiert. Das Buch, eine Reportage über den »Anschluss«, war von Eugen Lennhoff 1938, kurz nach seiner abenteuerlichen Flucht aus Wien, im Londoner Exil verfasst worden. Als Autor einer den zeithistorischen Kontext beschreibenden Einführung sekundierte ihm Paul Frischauer, Schriftsteller und Mitglied von bekannten Wiener Zeitungsverleger- und Journalistenfamilien (Klebinder bzw. Frischauer); er war schon 1934 emigriert. Zudem taucht Lennhoff, wenngleich nur kurz erwähnt, auch in Irvings Roman Eine Mittelgewichtsehe auf. Und immer ist es der berühmte Wiener Journalist, der erbitterte Nazi-Gegner, für den sich der amerikanische Schriftsteller interessiert.
Doch Eugen Lennhoff, der 1891 in Basel als Sohn eines jüdischen Bankiers geboren wurde – die Familie hieß ursprünglich übrigens Löwy – und viele Jahre im Pratercottage wohnte, er führte ein Leben, das von zwei biografischen Strängen bestimmt wurde: Er war auch ein hochrangiger Freimaurer.

Diesbezügliche Notizen: Im Jahr 1920 wird Lennhoff in die Grenzloge Zukunft aufgenommen. Sein Bürge war Josef Carl Löwenberg, Generaldirektor der österreichischen Niederlassung der New York-Versicherung, ein Mann mit interessantem familiären Umfeld: Wir begegnen hier dem renommierten Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor Josef Hupka; wir begegnen hier der viel zu früh verstorbenen Irene Hatschek, Gattin des erfolgreichen Architekten Arnold Hatschek (er hatte unter anderem die Villa Rustenschacherallee 28 entworfen), und wir begegnen hier vor allem auch dem in Prag ansässigen Arnold Weissberger (gest. 1913): Es war Weissbergers Empfehlung gewesen, die Franz Kafka 1907 zu seinem Job bei der Generali-Versicherung (Assicurazioni Generali) verholfen hatte.2

Parallel zu diesem biografisch bedeutsamen, von Josef Carl Löwenberg unterstützten Schritt – und nach wie vor befinden wir uns im Jahr 1920 – verlobt sich Eugen Lennhoff, der »bekannte Publizist« (Quelle: Wiener Sonn- und Montagszeitung) und Redakteur des im Steyrermühl-Konzern beheimateten Neuen Wiener Tagblattes, mit Gertrud Dubsky, Tochter des Mediziners Dr. Eduard Dubsky.
(mehr …)