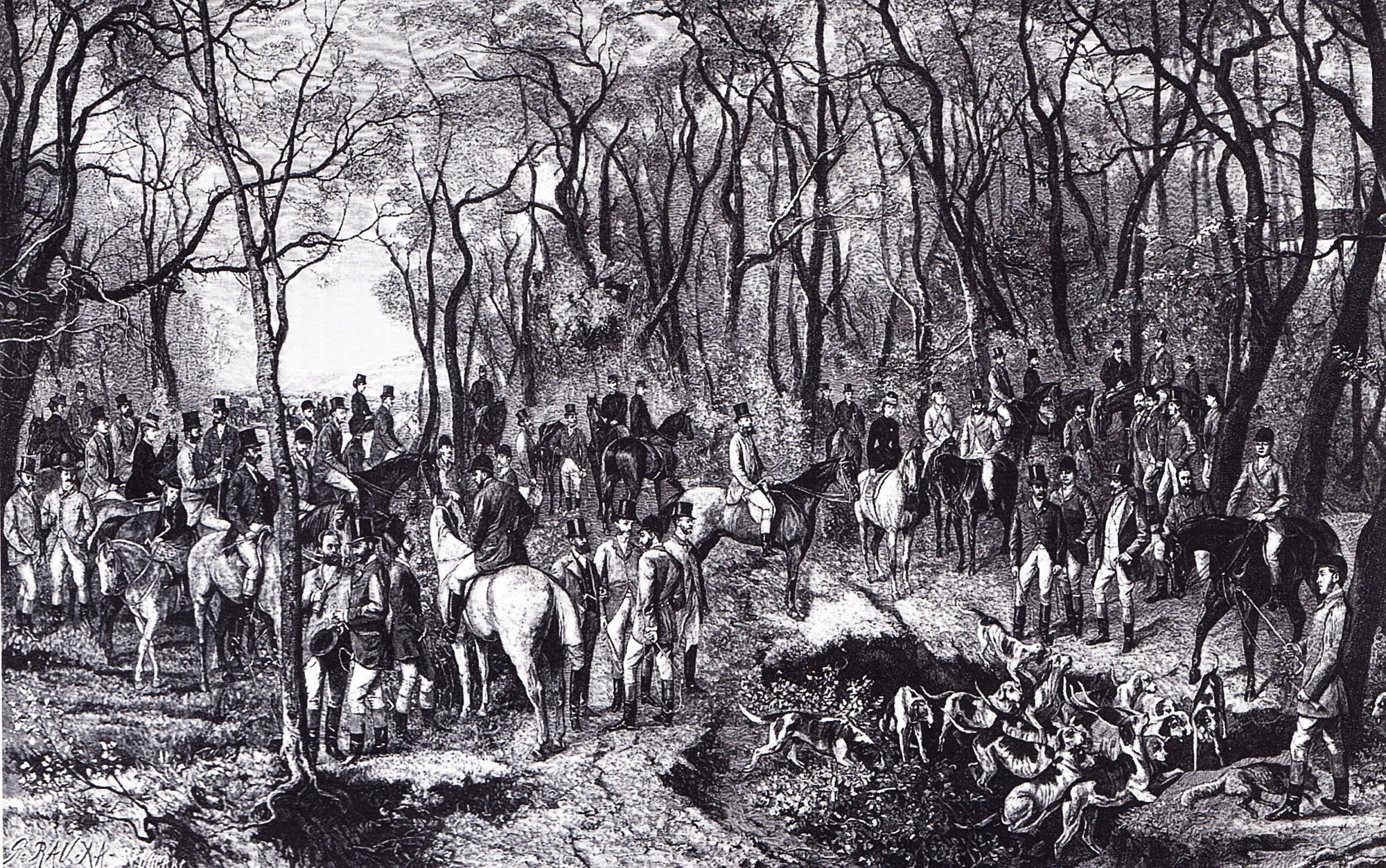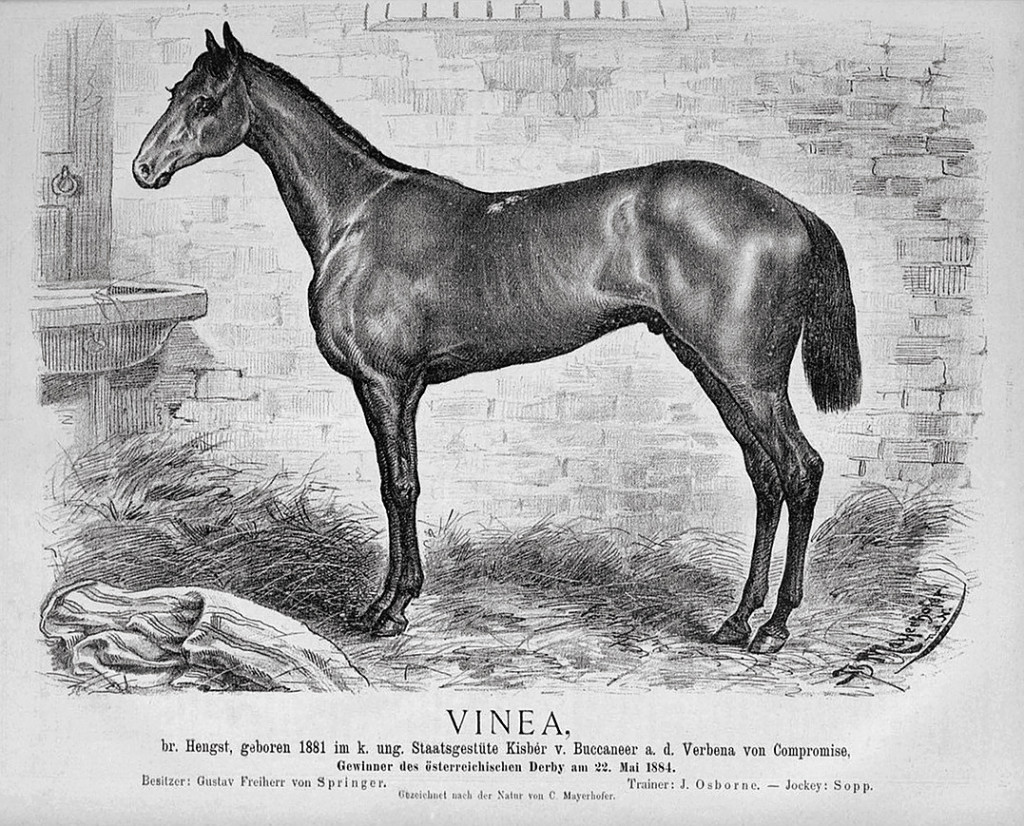Das Ableben von Stanzy Urban. Ludwig Urban, Laufbergergasse 12 (1910)

Die Büros waren schon längst bezogen – erste Meldungen dazu gab es im November 1909 –, als der Kaiser im März 1911 endlich zur feierlichen Eröffnung erschien. Anwesend im neuen Haus der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz war natürlich auch Karl König, der Architekt des riesigen Gebäudes, ein bedeutender Protagonist der Ringstraßenepoche. Er klagte Franz Joseph I. sein Leid: Bei den Jungen gelte er als rückständig. Der Monarch, diesbezüglich fraglos ein Seelenverwandter des bedrückten Baukünstlers, fand tröstende Worte: »Im Gegenteil! Es tut einem ordentlich wohl, wenn man so ein Gebäude sieht.« (Neue Freie Presse, 27. März 1911, S. 5) Und tatsächlich, wenngleich Franz Joseph dies wohl eher nicht gemeint hatte, verfügte das Gebäude von Beginn an über einige interessante Details, wie Staubsaugeranschlüsse im Foyer, oder etwa, im großen Festsaal, Knäufe, die, in der Wand neben dem großen Kaiserporträt eingelassen, als Halterung von Projektionsleinwänden dienten.
Ein moderner, multifunktionaler Saal im Haus der Industrie ist – und nun befinden wir uns in … WEITERLESEN.