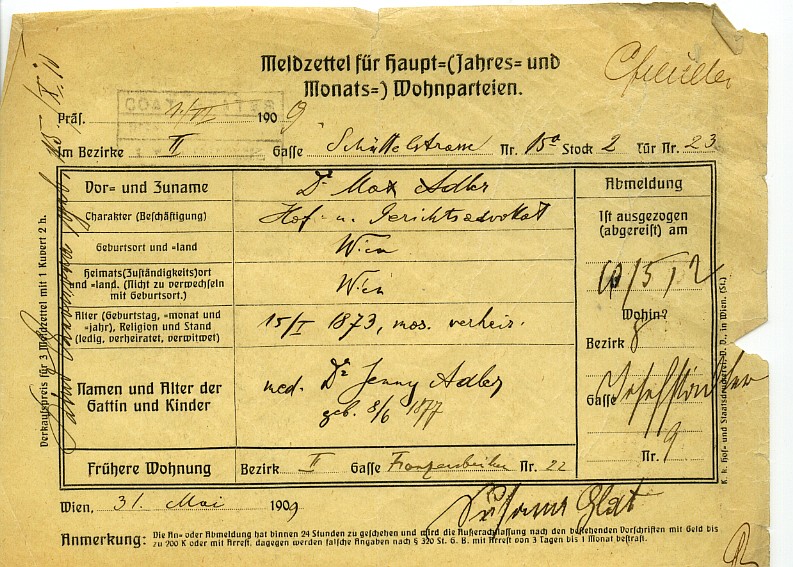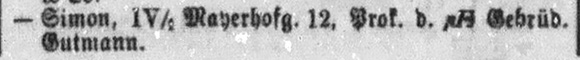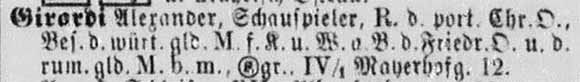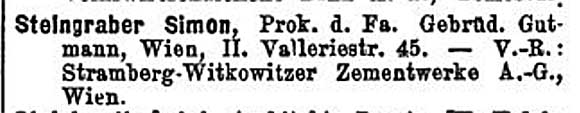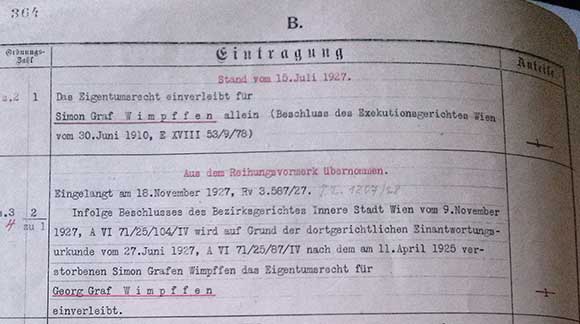Der Verkauf der Entreprise des pompes funèbres an die Stadt Wien (1907)
Im Jahr 1907 wird die Entreprise des pompes funèbres – sie war, wie in diesem Blog schon erwähnt, 1868 von dem im Pratercottage ansässigen niederländischen Generalkonsul Owen Maurits Roberts van Son erworben und danach in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden – an die Stadt Wien verkauft. Treibende Kraft von Seiten des Verkäufers: Owen Maurits Roberts van Son, der dem Verwaltungsrat des Bestattungsunternehmens vorstand.
Dazu war in der Wiener Tageszeitung Die Zeit am 15. Februar 1907, Seite 4, unter dem Titel Verstadtlichung der Leichenbestattung Folgendes zu lesen (online auf ANNO):
»Vorgestern wurde nun der Vertrag unterzeichnet, wonach beide Unternehmungen, vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates und des Gemeinderates, an der wohl kaum zu zweifeln ist, am 1. April d. J. mit ihrem ganzen Fundus und ihrem Kundenkreis in das Eigentum der Gemeinde Wien übergehen, und zwar die Concordia um den Preis von 650.000 Kronen und die Entreprise um jenen von 1,700.000 Kronen. […|
Bezüglich der Entreprise wurde Folgendes vereinbart: Diese ist bekanntlich Aktiengesellschaft und wurde im Jahre 1870 unter dem Titel Erste Wiener Leichenbestattungsanstalt Entreprise des Pompes Funèbres gegründet. An der Spitze ihres Verwaltungsrates steht gegenwärtig Generalkonsul O. M. Roberts van Son. Das Aktienkapital beträgt eine Million Kronen Nominale, im … WEITERLESEN.