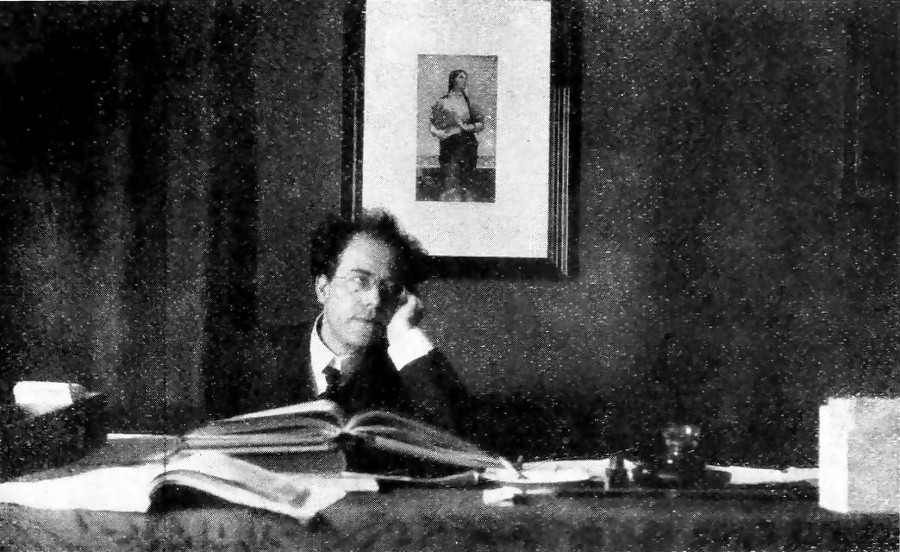Franz Kafkas Wiener Verwandtschaft: Richard Lanner, Rustenschacherallee 30 (1906–1923), Teil 2
Prolog
»Nein, um Gottes Willen, ich bin noch nicht verlobt!«, schrieb Thomas Mann im Juni 1904 hektisch nach Wien. Die dramatische Post erging an Richard Schaukal, Ministerialbeamter, Schriftsteller und Schwiegersohn des enorm wohlhabenden mährischen Hutfabrikanten Johann Hückel (Neutitschein/Nový Jičín). Noch musste sich der offenbar sehr interessierte Schaukal einige Monate gedulden, bis schließlich Anfang Oktober die erlösende Frohbotschaft aus Bayern eintraf: Thomas Mann informierte den von ihm sehr geschätzten Korrespondenzpartner offiziell über seine Verlobung mit Katia Pringsheim. Das glückliche Paar hatte sich durch die gemeinsame Bekannte Elsa Bernstein, Münchner Schriftstellerin und Salonnière, kennen gelernt. Elsas Vater Heinrich Porges, bekanntlich ein enger Mitarbeiter Richard Wagners, wurde in diesem Blog ja schon prominent erwähnt: Als, wir erinnern uns, Schwager von Ottilie Hirschl-Porges-Natter, die im Pratercottage aufgewachsen und viele Jahre ansässig war [1].
Im selben Jahr, 1904 also, las Franz Kafka in Prag erneut Thomas Manns Novelle Tonio Kröger. Ein Brief gibt darüber Auskunft, adressiert an seinen Freund Max Brod. Brod, der seinerseits schon bald mit Richard Schaukal korrespondieren wird.
Am 20. Oktober 1904 trat zudem Ernst Lanner vor den Traualtar [2]. Sein Vater Ludwig, ein kulturinteressierter Industrieller, der in unmittelbarer Nachbarschaft von Kunsthistorischem Museum und Hofburg residierte (Babenbergerstraße 9, 1010 Wien), hieß ursprünglich Löwy. 1887 hatte er, wohl um antisemitischen Anwürfen zu entgehen, seinen Namen ändern lassen [3] – Ludwig Löwy/Lanner also, der Cousin von Julie, Franz Kafkas Mutter, und auch der Bruder von Alexander und Eduard Lanner, die in Teil I dieser kleinen Serie ihren Auftritt hatten. Ernst nun, Ludwigs Sohn, vermählte sich mit einer jungen Dame, die mit Stolz einen international angesehenen Namen trug: (Adelheid) Paula Habig entstammte einer berühmten Wiener Hutmacherdynastie, die man natürlich auch in Prag bestens kannte. Habig-Hüte wurden etwa von der auf internationale Herrenhüte spezialisierten Firma C. Krise in der Zeltnergasse (Celetná), und somit unweit der Kafkas, verkauft [4]. Ob Richard Schaukal, Thomas Manns »Brieffreund«, wohl als Gast an dieser Hochzeit teilnahm? Ja, vielleicht, denn – Überraschung! – die Hückels und Habigs waren seit 1903 ebenfalls verschwägert [5].
Wir sehen uns hier also mit einem komplex geknüpften, für manche vermutlich durchaus verwirrend anmutenden Familiengeflecht konfrontiert, in dem sich überdies auch Richard Lanner, der Bruder des glücklichen Bräutigams, wieder findet, ebenso seine Gattin Berta, geb. Hassreiter.
(mehr …)