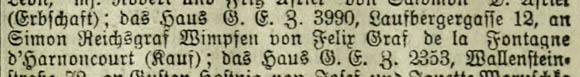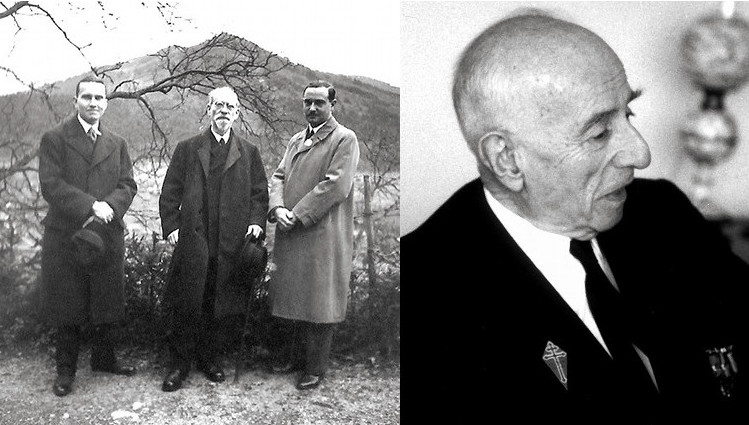Das Ableben von Stanzy Urban. Ludwig Urban, Laufbergergasse 12 (1910)
Die Büros waren schon längst bezogen – erste Meldungen dazu gab es im November 1909 –, als der Kaiser im März 1911 endlich zur feierlichen Eröffnung erschien. Anwesend im neuen Haus der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz war natürlich auch Karl König, der Architekt des riesigen Gebäudes, ein bedeutender Protagonist der Ringstraßenepoche. Er klagte Franz Joseph I. sein Leid: Bei den Jungen gelte er als rückständig. Der Monarch, diesbezüglich fraglos ein Seelenverwandter des bedrückten Baukünstlers, fand tröstende Worte: »Im Gegenteil! Es tut einem ordentlich wohl, wenn man so ein Gebäude sieht.« (Neue Freie Presse, 27. März 1911, S. 5) Und tatsächlich, wenngleich Franz Joseph dies wohl eher nicht gemeint hatte, verfügte das Gebäude von Beginn an über einige interessante Details, wie Staubsaugeranschlüsse im Foyer, oder etwa, im großen Festsaal, Knäufe, die, in der Wand neben dem großen Kaiserporträt eingelassen, als Halterung von Projektionsleinwänden dienten.
Ein moderner, multifunktionaler Saal im Haus der Industrie ist – und nun befinden wir uns in der Gegenwart – nach Ludwig Urban jun. (1876–1946) benannt. In jenen Jahren rund um die oben beschriebene Eröffnung des Gebäudes hatte der in der Ersten Republik ungemein einflussreiche und im austrofaschistischen Ständestaat auch politisch exponierte Großindustrielle (Brevillier-Urban) in der Villa Laufbergergasse 12 gelebt. Und dort, in diesem einst von Felix von Harnoncourt errichteten Haus, war 1910 auch seine erste Frau Anna Constanze (»Stanzy«) verstorben.

»Vicky«, wie Urban jun. laut der Schauspielerin Adrienne Gessner genannt wurde, taucht erstmals 1902 mit der Wohnadresse Laufbergergasse 12 in Lehmanns Adressbuch auf (Link). 1905 finden wir seinen Namen mit ebendieser Anschrift als Eigentümer im Häuserkataster von Josef Lenobel (Link). Der offenbar sehr charismatische Schraubenfabrikant interessierte sich aber nicht nur für Umsatzzahlen und Börsenberichte, nein, er war auch eine zentrale Persönlichkeit im Wiener Pferdesport. Schon früh entdecken wir in seinem Umfeld Simon von Wimpffen, den in diesem Blog schon erwähnten Kurzzeiteigentümer der Villa Harnoncourt (ein Nachfahre von Bernhard von Eskeles und Georg Simon von Sina übrigens), ebenso wie Victor Mautner von Markhof, später (1911) Trauzeuge bei »Vickys« zweiter Ehe mit Gertrud Eissler; beide Herren besaßen Rennställe und waren Pferdezüchter: »Herr Ludwig Urban jun. hat zwei ausgezeichnete amerikanische Zweigespanne in seinen Besitz gebracht, und zwar erwarb er Alzel und Neva Seeley von Graf Simon Wimpffen, Cora Carlton und Pattie G von Herrn Victor Mautner v. Markhof.« (Sport & Salon, 3. Mai 1900, S. 15)
(mehr …)