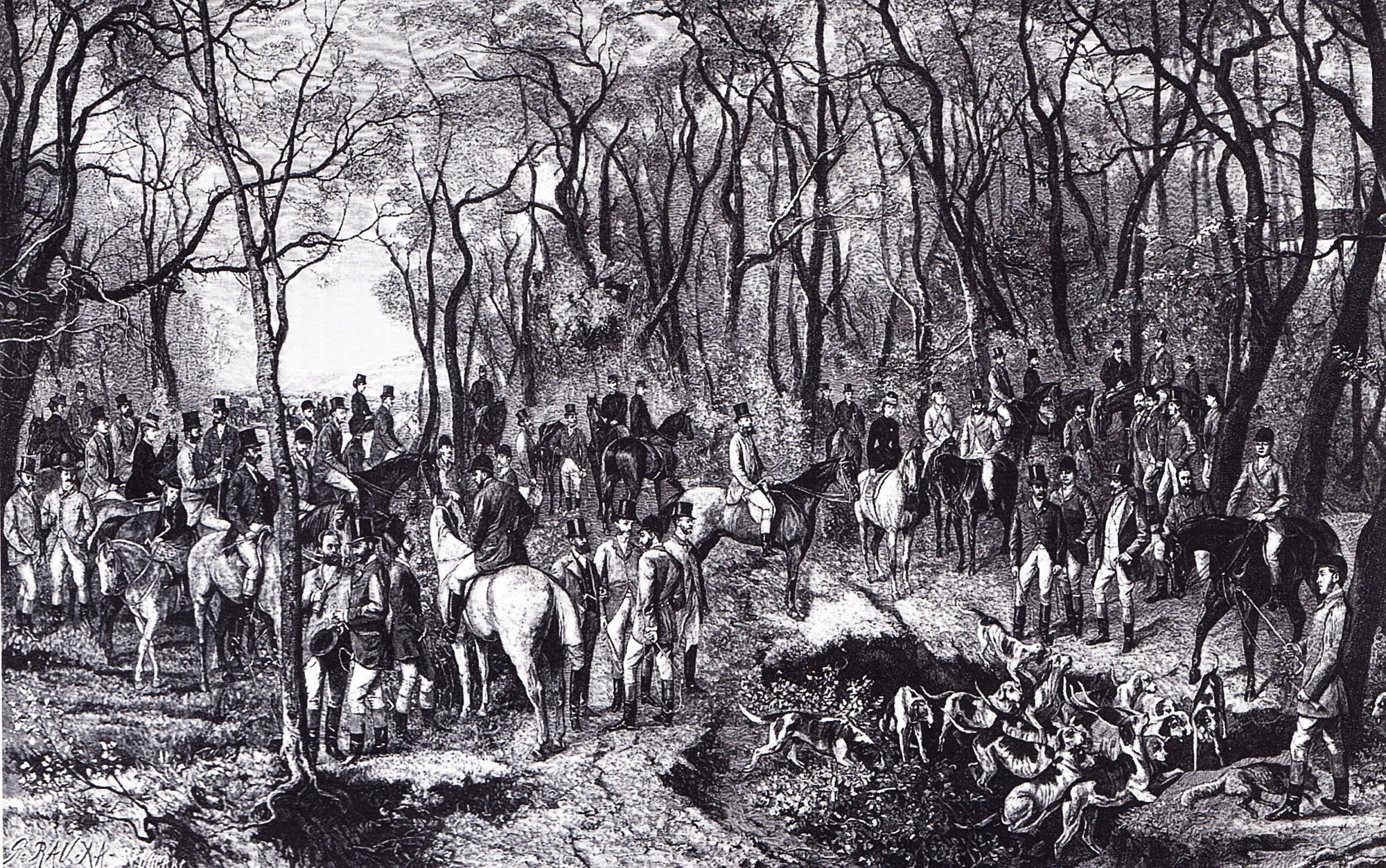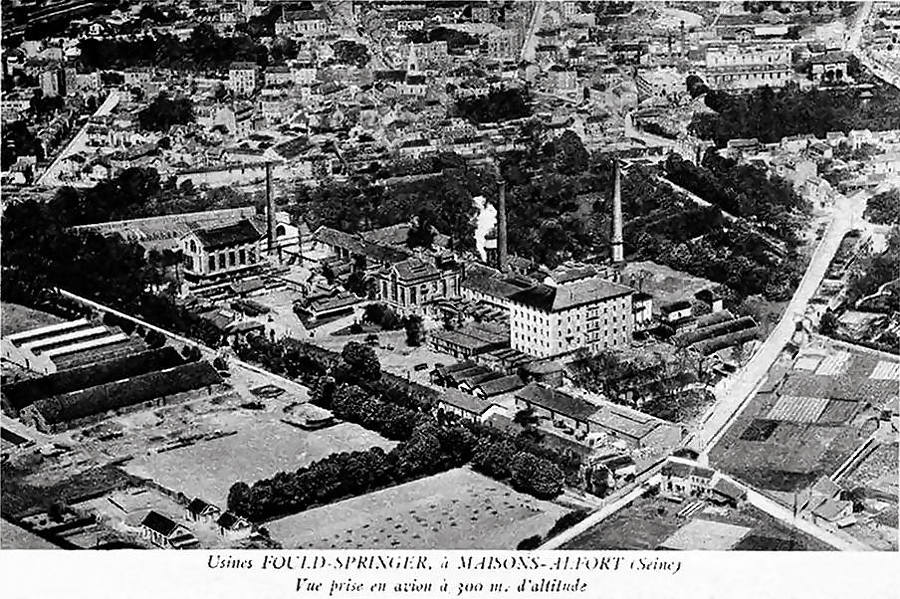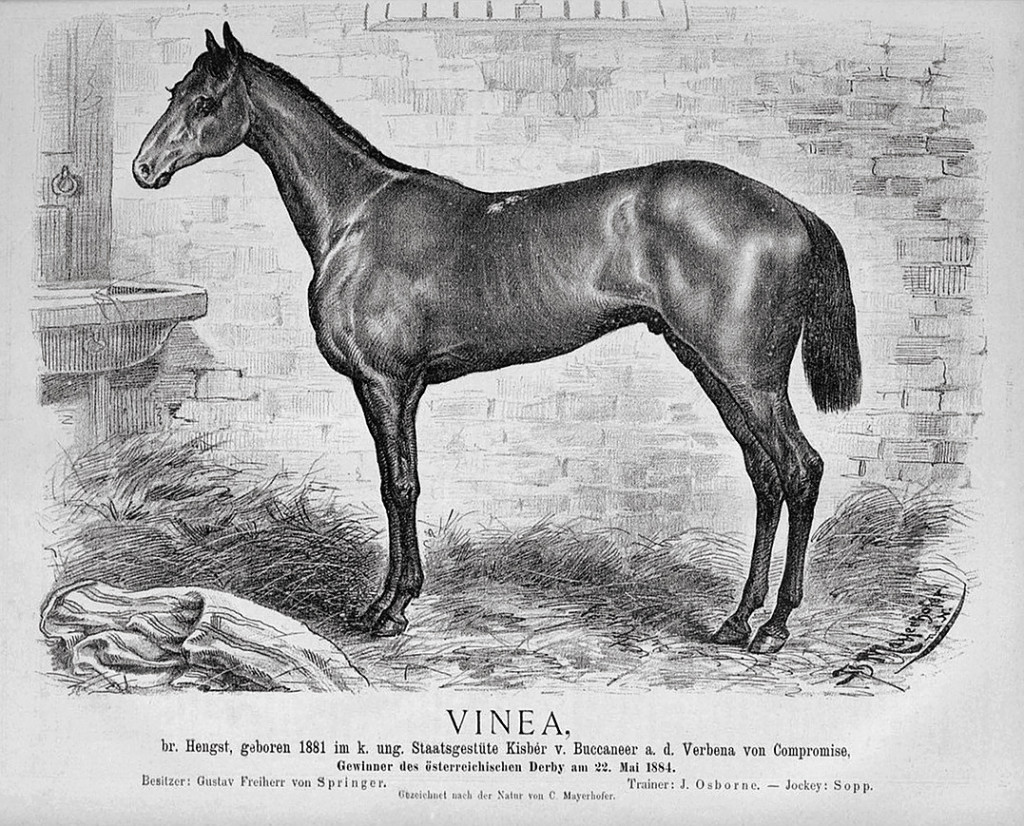Die Ferstels, die Doderers, die Marxergasse: Simon von Wimpffen, Teil 1
»Die aus dem Mittelalter stammende Kapelle des im Triestingtale gelegenen Ortes Fahrafeld ließ die Besitzerin des Gutes Gräfin Wimpffen-Sina nach Plänen des Architekten Max Freiherrn von Ferstel heuer umbauen. Die feierliche Einweihung der Kapelle fand am 21. v. M. statt. Der Pottensteiner Gesangverein nahm aus diesem Grund Anlass, am Vorabende dieser Feier der durch ihren Wohltätigkeitssinn sich allseitiger Verehrung erfreuenden Gräfin ein Ständchen zu bringen. Des berühmten Heinrich Ferstels Sohn zeigte auch hier eine bedeutende künstlerische Individualität durch auserlesenen Geschmack und feinsinnige Empfindung.«
(Wiener Bauindustrie-Zeitung, 1. November 1888)
August Zichy de Zich et Vásonykeő, ehemals Gouverneur von Fiume (heute: Rijeka) und Obersthofmarschall, verstarb am 4. Oktober 1925. Anwesend bei der feierlichen Einsegnung im Palais Zichy-Sina in der Beckmanngasse 10–12, 1140 Wien (heute Sitz der nordkoreanischen Botschaft) waren laut Neuem Wiener Journal (8. Oktober 1925, S. 10; online auf ANNO) unter anderem der bedeutende Kunstmäzen Felix (von) Oppenheimer (ein Freund Hugo von Hofmannsthals und Enkel von Sophie und Eduard von Todesco; er wird nach dem »Anschluss« am 15. November 1938 Selbstmord begehen), der Architekt Max (von) Ferstel und seine Gattin Charlotte sowie Zichys Schwager … WEITERLESEN.