
Er könnte einem Film von Erich von Stroheim entsprungen sein: Charmant, intelligent, gebildet, charismatisch, hedonistisch, skrupellos, amoralisch, zynisch, narzisstisch – all diese Zuschreibungen lassen sich auf den mehrere Jahre, bis zu seinem Tod, im Pratercottage ansässigen Grafen Josef Gizycki (1867–1926) anwenden. Der polnische Aristokrat und Sohn der Komponistin Ludmilla Gizycka-Zamoyska (1829–1889) war eine bekannte Erscheinung am Wiener Parkett, ein ideenreicher Protagonist des Jockey-Clubs, ein Mitbegründer(1) des ersten österreichischen Reit- und Poloklubs(2), und selbst im Verwaltungsrat der Hotel Imperial Aktiengesellschaft ist sein Name zu finden. Für die ambivalenten Erinnerungen an den rastlosen Herrenreiter und Gutsbesitzer sorgen Bücher aus Großbritannien und den USA, die zwei sehr unterschiedliche Frauen porträtieren: Etti Plesch (geb. Maria Anna Gräfin von Wurmbrand-Stuppach), die aus Wien stammende Tochter von Mary Vetseras Cousine May Baltazzi und wahrscheinlich ein uneheliches Kind des – freundlich formuliert – polyamourösen Grafen, sowie Eleanor »Cissy« Patterson, seine prominente US-amerikanische Exgattin, die Gizycki verlassen hatte und sich danach mit ihm einen hasserfüllten Scheidungskrieg lieferte. Der transatlantische Kampf um die gemeinsame Tochter Felicia, die Gizycki in einer filmreifen Aktion sogar entführt hatte, wurde unter Beteiligung von US-Präsident William Howard Taft und dem russischen Zaren Nikolaus II. ausgetragen und am 4. April 1999 von der New York Times (Felicia G. Magruder, Ex-Countess, Dies at 93; eine Abschrift findet sich aktuell zudem in Felicia Gizycka Magruders Profil auf Geni.com) sowie am 17. Mai 1999 vom britischen Independent (Obituary: Countess Felicia Gizycka) erneut thematisiert. In der Folge wird hier nun auf die beiden Bücher, die spezifische Aspekte in Gizyckis Leben vor seinem Umzug in die Schüttelstraße beleuchten, näher eingegangen.
Hugo Vickers: Horses and Husbands. The Memoirs of Etti Plesch. The Dovecote Press, Dorset 2007.
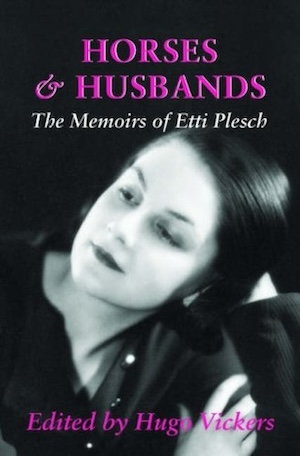
Das Leben von Etti Plesch (1914–2003) oszillierte zwischen großen Turf-Erfolgen als Rennpferd-Besitzerin und diversen Erlebnissen als Mitglied der internationalen High Society mit Hauptwohnsitz an der Côte d’Azur (vorwiegend die Villa Leonina in Beaulieu-sur-Mer, sie wurde später an den italienischen Multimilliardär Leonardo Del Vecchio verkauft(3)). Dementsprechend beginnen ihre vom britischen Autor Hugo Vickers vor einigen Jahren posthum veröffentlichten Memoiren mit Pleschs aufsehenerregenden Derby-Siegen in Epsom (1961 und 1980), bevor sie sich intensiv dem Privatleben widmen. Für uns ist allerdings vorwiegend »Count Josef Gizycki« von Interesse, dem wir schon auf Seite 33 begegnen: Er übte auf die um vieles jüngere May Baltazzi (1885–1981), eine Tochter von Aristides Baltazzi und Maria Theresia von Stockau, ganz offensichtlich eine enorme Anziehungskraft aus, wohl auch, weil er, so Plesch, »ihren Onkeln, den Baltazzis, ähnelte«: »Ich glaube, meine Mutter liebte Gizycki und ich habe mich oft gefragt, ob das der Grund war, warum sie später nie wieder heiratete« (May Baltazzis 1909 geschlossene Ehe mit Ferdinand von Wurmbrand-Stuppach währte nur knapp zehn Jahre).
Vielsagend beschreibt Plesch die Beziehung zwischen ihrer Mutter und Josef von Gizycki als »eher unkonventionelle Freundschaft«, der Graf, so erfährt man weiter, sei gutaussehend und sehr intelligent gewesen, ein überaus gebildeter Mann, der sich in mehreren Sprachen fließend unterhalten konnte. Mit seinen Fähigkeiten wäre ihm laut ihrer Mutter alles möglich gewesen, er hätte sogar »Premierminister werden können, wäre er nicht so faul gewesen.« Er liebte zudem das Glücksspiel und war ein exzellenter Weinkenner (May Baltazzi: »He would teach his various women the different tastes of different vintages and years«), aber, so wird May in den Memoiren ihrer Tochter zitiert, »most of all ›women fascinated him and challenged him. And he fascinated women.‹« Explizitere Aussagen über den in ganz Wien bekannten »Kavalier« kann man hier nicht finden (die sind im Buch über Cissy Patterson vertreten), aber vielleicht war ihre Mutter in Anbetracht der vermutlichen – und auch im Klappentext von Horses & Husbands thematisierten – Vaterschaft Gizyckis ihr gegenüber diesbezüglich zurückhaltend. Die Beziehung zwischen den beiden Frauen war jedenfalls sehr eng – May Baltazzi lebte bis zu ihrem Tod im Jahr 1981 auch in Monte Carlo, in der Nähe ihrer Tochter also.
In weiterer Folge lernen wir dann Etti Pleschs Ehemänner kennen: Insgesamt waren es sechs, darunter, neben zwei US-Amerikanern, auch Paul »Pali« Pálffy, der zwei Jahre vor der Hochzeit das berühmte Wiener Restaurant Zu den drei Husaren mitbegründet hatte(4)(5) und Plesch für die freigeistige französische Schriftstellerin Louise de Vilmorin verließ. Vilmorin, zu deren Lebensgefährten unter anderem André Malraux zählte, hypnotisierte überdies Thomas Esterházy de Galántha (ein Mitglied der ungarischen Magnatendynastie), Pleschs Gatten Nummer 3 und Vater ihrer Tochter – das Ende dieser Ehe war damit ebenfalls besiegelt. Selbst ein Sohn des ehemaligen k.u.k. Außenministers Leopold Graf Berchtold reihte sich ein unter Etti Pleschs Angetrauten, bis sie schließlich in Paris, bei Gloria Guinness und Loel Guinness, Árpád Plesch, den schon damals gerüchteumrankten ungarischen Finanzexperten, »brillanten Spekulanten und größten Fachmann für Goldanleihen« (André Kostolany)(6), kennenlernte. Im Internet, speziell in Pleschs englischem Wikipedia-Eintrag, kursieren nach wie vor gravierende Vorwürfe zu ihm, die allerdings nicht fundiert belegt sind (daher erfolgt hier auch keine Verlinkung): Sie beruhen vorwiegend auf Anschuldigungen seiner Stieftochter Joanna Harcourt-Smith, Schriftstellerin und Lebensgefährtin von »LSD-Hohepriester« Timothy Leary, die auch in Errol Morris‘ Dokumentarfilm My Psychedelic Love Story (2020) wiederholt wurden.
Abschließend soll zudem an Etti Pleschs Schwager, den prominenten Mediziner János Plesch, erinnert werden, den man in Berlin nicht nur für seine Forschungen, sondern auch als kunstsinnigen Intellektuellen kannte und der unter anderem mit Albert Einstein befreundet war(7). János Plesch flüchtete 1933 vor den Nationalsozialisten nach London, das 1928 von Max Slevogt geschaffene Porträt Die Familie des Arztes János Plesch befindet sich im Jüdischen Museum Berlin.
Amanda Smith: Newspaper Titan. The Infamous Life and Monumental Times of Cissy Patterson. Alfred A. Knopf, New York 2011.
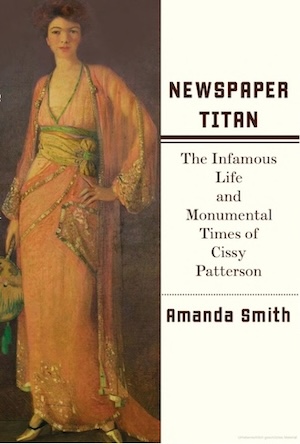
Während Etti Pleschs Memoiren von nostalgischen Erinnerungen ihrer Mutter bestimmt sind, wird Josef Gizycki in der von Amanda Smith verfassten Biografie über die Zeitungsverlegerin Cissy Patterson als narzisstisches Monster gezeichnet. Beklemmende Vorfälle füllen die Seiten, eine Grenzüberschreitung folgt der nächsten. Kennengelernt haben sich die beiden angeblich im Sommer 1902 in Mähren, in Napajedla, wo sich das berühmte Gestüt von May Baltazzis Eltern befand; zeitgenössische österreichische Tageszeitungen hingegen behaupteten, das Paar hätte sich erstmals während einer USA-Reise des Grafen getroffen. Für die 1881 geborene Amerikanerin war es ein match made in heaven, für ihre Eltern hingegen ein alarmierender Anlass zur Sorge. Patterson entstammte einer wohlhabenden und einflussreichen Familie, was, so die Befürchtung, auch einen potentiellen fortune hunter auf den Plan rufen könnte: So war schon ihr Großvater Joseph Medill Eigentümer der Chicago Tribune gewesen und hatte 1871–1873 zudem als Bürgermeister von Chicago amtiert. Also wurde Cissy Pattersons Onkel, der 1902 in Wien und danach im russischen St. Petersburg als US-Botschafter wirkende Robert S. McCormick, beauftragt, Erkundigungen über den vermeintlich reichen Gizycki einzuholen. Er gab wenig später grünes Licht: Alles bestens! McCormicks einzige Quelle: Der lebenslustige, allerdings auch dem Glücksspiel verfallene Graf Eugen Kinsky (1859-1939), der seinen Freund Gizycki fraglos in den höchsten Tönen lobte. Was nach einigem hin und her folgte, war ein Klassiker: Amerikanische Millionärstochter und verarmter europäischer Aristokrat geben ihren Vermählung bekannt, wobei als Trauzeuge des Bräutigams mit dem ungarischen Grafen Ivan Rubido-Zichy, der als Attaché an der k.u.k. Botschaft in Washington tätig war(8), ein weiteres Jockey-Club-Mitglied die Szenerie bereicherte. Zu den wenigen in Pattersons Umfeld wiederum, die Gizycki mit Sympathie begegneten, zählte ihre enge Freundin Alice Roosevelt, eine Tochter des damaligen US-Präsidenten Theodore Roosevelt, die ebenfalls bei der Hochzeit im April 1904 in Washington anwesend war(9) (ihr zu Ehren wurde von Gizycki ein Rennpferd nach ihr benannt, das 1905 in Karlsbad an den Start ging(10)).
Schon bald jedenfalls wurde Gizyckis neogotisches und ziemlich sanierungsbedüftiges Schloss im damals russischen, heute ukrainischen Novosielica (Fotos und nähere Informationen siehe hier und hier) laut Patterson zum Schauplatz unzähliger Dramen. Ihr Ehemann behandelte seine Angestellten miserabel, etliche Kinder vor Ort hatten auffällige Ähnlichkeiten mit ihm, und in Gizyckis Herrenzimmer war seine verstörte Gattin gleich bei ihrer ersten Ankunft auf einen großen Tisch mit unzähligen gerahmten Fotos gestoßen: Porträts von vielen verschiedenen Frauen, in deren Mitte sich prominent der Gipsabdruck eines Frauenfußes befand – mit einer kleinen goldenen Kette um den Knöchel. Eine bizarr-exzentrische Komposition, von der Regisseur Stroheim vermutlich begeistert gewesen wäre… Gizyckis englische Geliebte und die gemeinsame kleine Tochter, die im Schloss gelebt hatten, sie waren verschwunden, ihre Räumlichkeiten allerdings präsentierten sich unverändert, auch Haarnadeln ihrer Vorgängerin hatte Cissy Patterson entdeckt. Alles Weitere, von Gizyckis Schulden über seinen Kontrollwahn (er verbot ihr angeblich zu lesen oder Polnisch zu lernen), seine unkontrollierten Gewaltausbrüche, seine auch während der Ehe regelmäßigen Besuche im Wiener Nobelbordell von Madame Rosa (Köllnerhofgasse 5, 1921 geschlossen(11)), die von ihm sogar minutiös in einem Notizbuch festgehalten wurden, oder sein oft kommentarloses, manchmal tage- oder sogar wochenlanges Verschwinden kann man ebenfalls in Smiths Biografie über Cissy Patterson nachlesen. Und ja, natürlich war es ein Rosenkrieg und mehr als hundert Jahre später können diese Behauptungen nicht mehr verifiziert werden. Allerdings erzählte May Baltazzi, dass sich Gizycki schon bald mit seiner jungen Ehefrau (die später auch problematische Persönlichkeitszüge offenbarte) gelangweilt hatte. Und dass er in Bezug auf Frauen rücksichtlos seine Interessen verfolgte, dürfte außer Streit stehen.
Zu seinen Geliebten zählte laut den Historikerinnen Martha Schad und Karina Urbach übrigens auch die noch minderjährige, mittlerweile als »Hitlers Spionin« bekannte Stephanie von Hohenlohe, geb. Richter (sie war damals etwa fünfzehn Jahre alt).(12)(13) Und eine Wiener Adresse soll ebenfalls nachgereicht werden: Rund um das Jahr 1907 bewohnte das Ehepaar Gizycki-Patterson bei den Wien-Aufenthalten eine Mietwohnung in der Hoyosgasse 5, im Palais Hoyos-Sprinzenstein also, wo laut Lehmanns Adressbuch (1907) nicht nur »Gizycki Josef Gf., Gutsbesitzer« (Link), sondern unter anderem auch »Hoyos-Sprinzenstein Ernst jun. Gf.« anzutreffen war (Link).
Nun aber zur Entführung der 1905 geborenen Tochter Felicia Leonora, eine Aktion, die weltweite Schlagzeilen generierte. Gizycki war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der ihm vererbten Besitzungen wie Novosielica schon russischer Staatsbürger (daher auch die Involvierung von Zar Nikolaus II. in die Entführungscausa). Geboren wurde er aber im damals österreichischen Lemberg/Lviv/Lwów, und das Herrenhaus seiner Familie befand sich im damals ungarischen, heute slowakischen Brestovany, wo er auch bestattet wurde. Nachfolgend sind nun einige Beispiele für die zeitgenössische Berichterstattung in Wiener Medien angeführt:
Die Entführung der Komtesse Gizycki. Ein gefälschter Befehl des Zaren. In: Neues Wiener Tagblatt, 6. Februar 1910, S. 7 (online auf ANNO).
Der Kampf um das Millionärskind. In: Illustrierte Kronen-Zeitung, 5. Februar 1911, S. 2 (online auf ANNO).
Graf und Dollarprinzessin. In: Neuigkeit-Welt-Blatt, 17. März 1911, S. 9 (online auf ANNO).
(2) Knapp drei Jahre später stellte sich laut Allgemeiner Sport-Zeitung (5. Jänner 1913, S. 7, online auf ANNO) die Leitung des Reit- und Poloklubs wie folgt dar: »Präsident Graf Heinrich Larisch-Moennich; Vizepräsidenten: Fürst Otto zu Windisch-Graetz, Prinz Vinzenz Auersperg; Technische Kommission: Graf Géza Andrássy, Prinz Ferdinand Auersperg, Graf Karl Buquoy, Graf Franz Clam-Gallas, Graf Rudolf Erdödy jun, Graf Alois Esterházy, Graf Paul Esterházy, Graf Josef Gizycki, Graf Rudolf Hoyos, Graf Ferdinand Kinsky, Graf Karl Khuen-Belasi, Baron Franz von Mayr-Melnhof, Oberst Ernst Merhal, Baron Louis Rothschild, Oberstleutnant Ottokar Ritter von Streeruwitz, Fürst Karl Weikersheim, Graf Ferdinand Wurmbrand. Zu Revisoren wurden die Herren Baron Hermann Königswarter und Markgraf Alfons Karl Pallavicini berufen. Das Sekretariat führt Hauptmann d. R. Kamillo Mittenhuber.«
(3) https://www.rainews.it/articoli/2022/08/del-vecchio-alla-moglie-le-ville-e-a-milleri-azioni-fba82b3d-2fc5-4d1f-82ce-686a4549cbef.html
(4) Drei Husaren eröffnen in Wien ein Restaurant. In: Wiener Sonn- und Montagszeitung, 18. September 1933, S. 6 (online auf ANNO).
(5) Heirat der Gräfin Wurmbrand-Stuppach. In: Der Morgen. Wiener Montagblatt, 2. Dezember 1935, S. 4 (online auf ANNO).
(6) André Kostolany: Die Kunst, über Geld nachzudenken. Ullstein Ebooks 2015 (Vorschau auf Google Books).
(7) Hubert Goenner: Einstein in Berlin. 1914-1933. Verlag C. H. Beck, München 2005, S. 267 (Vorschau auf Google Books).
(8) Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1904, Schematismus Staat, S. 244 (online auf ANNO).
(9) Fresno Evening Democrat (später auch: Fresno Bee), Volume XXXVI, Number 10, 14. April 1904, S. 7 (online)
(10) Rennen zu Karlsbad. In: Neues Wiener Journal, 5. Juli 1905, S. 9 (online auf ANNO).
(11) Das Ende der »Frauenhäuser« in Wien. In: Illustrierte Kronen-Zeitung, 26. Jänner 1921, S. 5–6 (online auf ANNO).
(12) Martha Schad: Stephanie von Hohenlohe. Hitlers jüdische Spionin. F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH 2012 (genannt als »Joseph Gisycki«; Neuauflage des 2002 im Heyne Verlag erschienenen Titels Hitlers Spionin. Das Leben der Stephanie von Hohenlohe).
(13) Karina Urbach: Hitlers heimliche Helfer. Der Adel im Dienst der Macht. Theiss Verlag 2016 (Vorschau der aktualisierten Auflage auf Google Books, 2023) .
