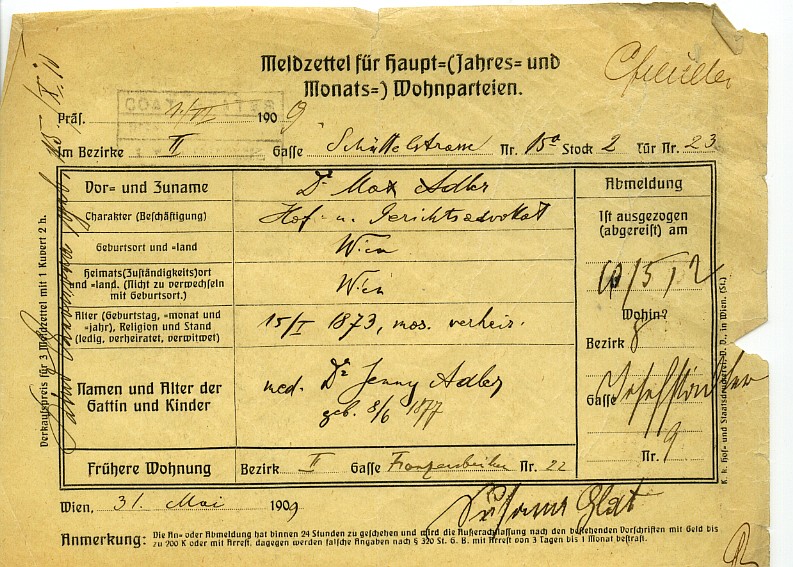Seltenes Bild: Ein Blick in die Franzensbrückenstraße mit dem Praterstern, dem Tegetthoff-Denkmal, der Verbindungsbahn und, links daran angrenzend, der Lagerhausanlage (vor 1907; ÖNB/AKON)
Unablässig und mit höchster Konzentration arbeitet Hermann Broch an seinen Texten. Später werden sie in die Romantrilogie Die Schlafwandler einfließen. Weiß der Schriftsteller von den erheblichen Umwälzungen, die seinen Onkel August Schnabel beschäftigen? Broch nennt ihn »Gustl«, Schnabel ist der Bruder seiner Mutter [1].
Es sind die Lagerhäuser an der Franzensbrückenstraße, die »Gustls« uneingeschränkte Aufmerksamkeit beanspruchen. Dunkel und wuchtig ragen sie zwischen Verbindungsbahn und Hauptallee empor, ein riesiger Gebäudekomplex, den man nur selten auf Ansichtskarten wiederfindet. Wenig verwunderlich, eigentlich: Die Anlage bildet einen irritierenden Störfaktor in der akzentuierten Erzählung vom bunten Leben rund um das weltberühmte Riesenrad. Ja, man kann sich des Gedankens nicht erwehren, dass sie von den Wiener Touristikern immer schon versteckt wurde.
Als Eigentümerin des für die Infrastruktur der Donaumetropole so bedeutenden Unternehmens, das von der k.k. Wiener Handelsbank für den Produkten- und Warenverkehr noch vor seinem kommunalen Pendant gegründet wurde [2] und für dessen Erscheinungsbild auch Wilhelm von Flattich, der Architekt des Südbahnhofes, gesorgt hatte, agiert die Erste österreichische Aktiengesellschaft für öffentliche Lagerhäuser. August Schnabel ist Vizepräsident des Verwaltungsrates. Er beklagt nun – wir schreiben den September 1928, die glühende Sommerhitze ist vorüber, das deutschnational gefärbte Sängerfest auf der Jesuitenwiese ebenso – das viel zu frühe Ableben von Hugo Stein, ebenso wie Schnabel Verwaltungsrat der Lagerhäuser und mit diesem seit längerem geschäftlich verbandelt.
(mehr …)